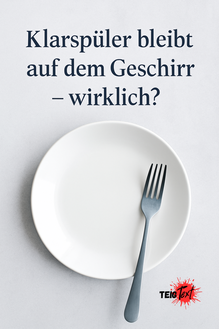
Ein Glanz, der Fragen aufwirft
Klarspüler gehört zu den Produkten, die man selten hinterfragt. Er steht ganz selbstverständlich neben Tabs und Salz im Supermarktregal, wird regelmäßig nachgefüllt – und verschwindet still in der Maschine. Hauptsache: keine Tropfen, keine Flecken, schöner Glanz.
Aber irgendwann habe ich mich gefragt:
Bleibt Klarspüler eigentlich auf dem Geschirr? Oder wird er vollständig abgespült?
Und wenn er bleibt – wo genau? Was steckt da eigentlich drin? Und was macht das auf Dauer mit dem Körper, wenn wir täglich von diesen Oberflächen essen,
trinken, ablecken?
Was harmlos klingt, ist bei näherem Hinsehen ein durchaus heikles Thema – besonders dann, wenn man wie ich täglich mit empfindlichen Menschen zu tun hat. Mit Allergien, Reizdarm, Histaminproblemen.
1. Wofür ist Klarspüler eigentlich gedacht?
Klarspüler hat nur eine Aufgabe:
Er soll das Wasser vom Geschirr abperlen lassen.
So entstehen keine Kalkflecken, keine Schlieren, keine Tropfenränder. Das Geschirr kommt sauber und streifenfrei aus der Maschine – was in Haushalten mit hartem Wasser (und hohem ästhetischem
Anspruch) als Vorteil empfunden wird.
Um diesen Effekt zu erzielen, enthält Klarspüler Tenside – also waschaktive Substanzen, die die Oberflächenspannung des Wassers herabsetzen. Dazu kommen Säuren, oft auf Zitronensäurebasis, die Kalk lösen. Und Alkohol, der das Ganze konserviert und zusätzlich für Glanz sorgt.
Das Problem dabei:
Diese Stoffe sind nicht vollständig flüchtig. Sie werden zwar mit dem Spülwasser verdünnt – aber sie
verdampfen nicht, sie zerfallen nicht in Nichts.
Sie bleiben in feinen Rückständen haften – vor allem dort, wo das Wasser nicht zu 100 % abläuft:
Auf Gläsern. Auf Tassen. Auf Besteck. Auf Tellern. Auf Töpfen und Pfannen. Auf Kindergeschirr. Auf Fressnäpfen.
Und genau hier beginnt die eigentliche Frage:
Wenn Klarspüler so formuliert ist, dass er auf dem Geschirr wirkt – wie wahrscheinlich ist es dann, dass er komplett verschwindet?
2. Was ist drin – und warum das problematisch ist
Ich hab’ es gemacht: die Flasche aus dem Schrank geholt, die Rückseite gelesen, gegoogelt, geschluckt.
Nicht wegen des Preises. Sondern wegen des Inhalts.
Denn was da in ganz harmlosen Worten aufgeführt wird – „nichtionische Tenside“, „Konservierungsmittel“, „Alkohole“ – ist in Wahrheit ein
Cocktail aus Stoffen, die wir in Lebensmitteln oder Kosmetik mit Hautkontakt nie durchwinken würden.
Und das ist keine Meinung, das ist Gesetzeslage.
Hier eine kleine Auswahl dessen, was in klassischen Klarspülern wie Somat oder Finish steckt – und warum das nicht einfach so runtergeht wie Wasser:
❈ Nichtionische Tenside (<15 %)
Sie machen das Wasser „flacher“, damit es besser abläuft – keine Tropfen, keine Schlieren. Technisch gesehen genial.
Aber: Diese Tenside bleiben auf dem Geschirr. Jeden Tag. In kleinen Rückständen – unsichtbar,
aber präsent.
• Schwer biologisch abbaubar
• Können Haut reizen
• Beeinflussen die Darmflora
• Gelten als potenzieller Risikofaktor bei Leaky-Gut, Neurodermitis, Histaminintoleranz
Fazit: Technisch top – aber körperlich nicht ohne.
❈ Methylchloroisothiazolinone & Methylisothiazolinone (MIT/CMIT)
Diese beiden Stoffe sind hochgradig sensibilisierend.
Sie lösen allergische Reaktionen aus, reizen die Haut, können Kontaktdermatitis verursachen.
In Kosmetika mit Hautkontakt sind sie in der EU verboten. In Spülmitteln aber weiterhin
erlaubt – denn der Kontakt gilt hier als indirekt.
So indirekt wie ein Löffel, den man sich in den Mund steckt.
→ Und genau da liegt das Problem.
Diese Stoffe gelangen über das Geschirr in den Körper – über die Lippen, die Schleimhaut, mit dem Essen.
Bei empfindlichen Menschen kann das reichen:
• Immunreaktionen
• stille Entzündungen
• Hautprobleme
• Verdauungsbeschwerden
❈ Kaliumsorbat (Potassium Sorbate)
Ein Konservierungsmittel, das auch in Lebensmitteln eingesetzt wird. Klingt harmloser – ist aber auch nicht ganz ohne.
• Kann bei empfindlicher Darmflora Reizungen auslösen
Es trägt bei häufiger Aufnahme zur Summenbelastung bei – und genau das ist der Punkt.
Denn es geht hier nicht um einzelne Stoffe in Einzeldosen.
Es geht um das Täglich. Immer wieder. Jeden Spülgang. Jedes Glas. Jeder Teller.
3. Wie reagiert der Körper?
Jetzt mal ganz direkt:
Würdest du dir freiwillig Konservierungsstoffe auf den Löffel tropfen?
Wahrscheinlich nicht.
Aber genau das passiert – wenn auch in winzig kleinen Dosen – täglich, wenn du aus Gläsern trinkst oder mit Besteck isst, das gerade aus der Spülmaschine kommt.
Diese Rückstände sind nicht akut giftig.
Aber sie wirken.
Langsam, leise, schleichend. Und zwar genau dort, wo der Körper besonders sensibel ist: an Schleimhäuten, im Verdauungstrakt, in der Immunabwehr.
❈ Schleimhautkontakt:
Die Innenseite deiner Lippen, der Gaumen, die Zunge – alles hoch durchlässige Gewebe.
Was dort auftrifft, wird schnell aufgenommen.
Klarspülerrückstände landen genau da. Und das jeden Tag, bei jeder Tasse, jedem Löffel, jedem Glas.
❈ Magen und Darm:
Viele der Inhaltsstoffe – allen voran Tenside und PEGs – gelten als potenziell schleimhautreizend.
Was bedeutet:
• Die natürliche Schutzbarriere wird gestört
• Die Darmschleimhaut wird durchlässiger
• Das Immunsystem schlägt schneller an
• Es entsteht stilles Entzündungspotenzial
Besonders kritisch wird das für Menschen mit:
• Reizdarm
• Nahrungsmittelunverträglichkeiten
• Histaminproblemen
• Hautkrankheiten (Neurodermitis, Rosazea, Psoriasis)
• Autoimmunerkrankungen
❈ Kinder, Ältere, chronisch Kranke:
Wenn der Körper weniger Puffer hat, wirken auch kleinste Mengen stärker.
Ein Kleinkind, das aus einem Plastikbecher trinkt, auf dem Klarspüler haftet, hat keine Filter.
Eine ältere Person mit geschwächtem Immunsystem genauso wenig.
Und wer sich „einfach nicht mehr richtig fit“ fühlt, aber keine klare Diagnose hat – landet schnell in der Grauzone zwischen Alltagsgift und Systemüberlastung.
Mir geht es hier nicht um Panikmache, sondern um bewusstes Hinschauen.
Der Körper reagiert auf das, was er täglich aufnimmt.
Klarspüler steht zwar nicht auf dem Speiseplan – gehört aber irgendwie trotzdem dazu.
4. Was sagen Gesetz und Hersteller?
Das Interessante an Klarspüler ist nicht nur, was drin ist – sondern was nicht gesagt wird.
Auf der Flasche findest du oft nur Sammelbezeichnungen wie
„<5 % nichtionische Tenside“ oder „Konservierungsmittel“ – aber keine exakten Stoffnamen.
Warum? Weil die EU-Gesetzgebung bei Reinigungsmitteln nur Mengenklassen verlangt – keine vollständige Offenlegung. Solange ein Stoff
unterhalb bestimmter Grenzwerte eingesetzt wird, muss er nicht einzeln benannt
werden.
Heißt im Klartext:
Du weißt nicht genau, was drin ist – nur dass es drin sein darf.
Und die Hersteller?
Die verweisen gerne auf die Sicherheit bei sachgemäßer Anwendung:
• Klarspüler wird automatisch dosiert
• Das Geschirr wird mit heißem Wasser gespült
• Rückstände sind minimal
→ Also: kein Problem.
Aber genau hier liegt der Haken.
Minimal bedeutet nicht: bedeutungslos.
Und „sachgemäß“ heißt eben nicht: „gesundheitlich unbedenklich“.
Denn:
• Rückstände bleiben trotzdem auf dem Geschirr
• Die Inhaltsstoffe haben bekannten Reizcharakter
• Und das Ganze passiert täglich
Was bei Lebensmitteln streng reguliert wäre, wird bei Reinigungsmitteln über den Umweg „nicht direkt aufgenommen“ umgangen. Nur ist ein Löffel im Mund nicht doch ziemlich direkt?
Warum weiß das kaum jemand ?
Weil Klarspüler nicht stinkt, nicht färbt, nicht schäumt und weil man annimmt, die Spülmaschine „wäscht das schon weg“.
5. Und was jetzt? – Alternativen, die Sinn machen
Du willst keinen Klarspüler mehr verwenden – aber deine Gläser sollen trotzdem nicht aussehen wie aus dem Campingurlaub? Verständlich.
Hier kommen drei Wege, wie du Klarspüler ersetzen oder zumindest verbessern kannst – je nach Anspruch, Maschine und Geduld.
1. Zitronensäurelösung – einfach und wirkungsvoll
• 1 EL Zitronensäurepulver in ca. 500 ml warmem Wasser auflösen
• In das Klarspülerfach füllen
• Alle paar Spülgänge nachfüllen
Zitronensäure hilft beim Abperlen, reduziert Kalk und ist deutlich sanfter für dich und die Umwelt.
Wichtig: Nicht das Pulver direkt einfüllen – es kann verklumpen und die Düse verstopfen.
2. Öko-Klarspüler – wenn's bequem sein soll
Marken wie Sonett, Ecover oder Frosch bieten Klarspüler ohne aggressive Zusätze an.
Sie enthalten keine PEGs, keine Isothiazolinone und keine synthetischen Duftstoffe.
3. Ganz ohne – funktioniert oft besser als gedacht
Je nach Spülmaschine und Wasserhärte kann man das Klarspülerfach auch einfach leer lassen.
Die Gläser trocknen dann vielleicht nicht ganz streifenfrei – aber sie sind frei von allem, was dort nichts zu suchen hat.
Tipp:
Mit Regeneriersalz (ganz normales Spülmaschinensalz) und Tabs in guter Qualität kannst du das meist gut ausgleichen. Ich trockne danach kurz nach – aber das geht schnell und ist für mich die beste Methode.
⤷ Ein Gedanke am Rande – und vielleicht nicht ganz unwichtig
In gewerblichen Spülmaschinen – etwa in Bäckereien, Cafés, Großküchen oder Mensen – läuft das Ganze oft noch schneller ab als zu Hause. Die Spüldauer beträgt manchmal nur 90 Sekunden, die Temperaturen sind höher, und der Klarspüler wird in konzentrierter Form zugesetzt, um Trocknungszeiten zu sparen.
Obwohl der Ablauf technisch durchgetaktet ist, bleibt dabei oft mehr Klarspüler auf dem Geschirr zurück – weil keine Zeit bleibt, gründlich nachzuspülen und das Geschirr direkt weiterverwendet wird: heiß, feucht, chemisch behandelt.
Ein Gedanke, der hängen bleibt, wenn das nächste Mal der Großküchenteller auf dem Tablett steht.
Was meint ihr dazu?
Benutzt ihr Klarspüler noch ganz selbstverständlich – oder seid ihr auch schon umgestiegen?
Ich freue mich, wenn ihr eure Erfahrungen in den Kommentaren teilt. Vielleicht bringt das noch mehr Licht ins Spülmaschinen-Dunkel.
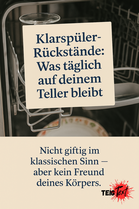
Übrigens:
Wenn du zuerst die Kolumne gelesen hast – hier findest du den ganzen Hintergrund dazu.
Falls nicht:
▸ Hier geht’s zur Kolumne → „Heimlich
mitgegessen?“

Kommentar schreiben